
Projektmanagement adaptiv gestalten Agil oder klassisch? Projektanalyse mit dem Agil-O-Mat

Agil, klassisch, oder hybrid – welches Vorgehen ist das richtige für Ihr Projekt? Mit dem Agil-O-Mat können Sie Ihr Vorhaben auf verschiedenen Ebenen analysieren und bestehende Projektmanagementansätze passgenau abwandeln und adaptieren.
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Projektmanagement adaptiv gestalten Agil oder klassisch? Projektanalyse mit dem Agil-O-Mat

Agil, klassisch, oder hybrid – welches Vorgehen ist das richtige für Ihr Projekt? Mit dem Agil-O-Mat können Sie Ihr Vorhaben auf verschiedenen Ebenen analysieren und bestehende Projektmanagementansätze passgenau abwandeln und adaptieren.
Management Summary
Als Mitglied erhalten Sie die wichtigsten Thesen des Beitrags zusammengefasst im Management Summary!
Agile Vorgehensweisen für Projekte liegen gerade im Trend – aber sie sind nicht immer auf ein bestimmtes Projekt anwendbar oder optimal dafür geeignet. Viele Projektverantwortliche stehen daher vor der Frage, welches Vorgehensmodell ihrem Projekt den größten Nutzen bringt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines an der TH Mittelhessen entwickelten Kriterienkatalogs eine systematische Analyse durchführen können und welche Vorgehensweise sich am ehesten für Ihr Projekt eignet. Der sogenannte Agil-O-Mat gibt insbesondere Projektleitenden und Mitarbeitenden im PMO konkrete Hinweise für ihren Projektalltag. Der vorliegende Beitrag beschreibt die Hintergründe, den Aufbau und die Anwendung des Agil-O-Mats. Der Agil-O-Mat steht Ihnen auch unter "Agil-O-Mat: Klassisch oder agil - Entscheidungsanalyse | Tool Excel" zum Herunterladen im projektmagazin zur Verfügung.
Auf ein passgenaues Projektvorgehen kommt es an!
Im modernen Projektmanagement geht es vermehrt um eine Abwägung zwischen agilen und plangetriebenen (oft "klassisch" genannten) Vorgehensweisen (Timinger, 2017; Seel/Timinger, 2017). Das betrifft nicht nur das Vorgehensmodell im Sinn des Projektablaufs, sondern insbesondere auch den Führungsstil und die generelle Unternehmenskultur. Unabhängig von der unmittelbaren Charakteristik eines Projekts sind auch die entsprechenden Umfeldfaktoren für die Wahl des Ansatzes relevant: Agiles Vorgehen wird eine bürokratisch-hierarchische Organisation nicht zum Erfolg führen. Eine dynamisch-kreative Organisation wird grundsätzlich mit der Einhaltung von Plänen Schwierigkeiten haben.
Die Managementerfordernisse von Projekten schwanken letztlich einzelfallbezogen entsprechend ihrer Rahmenbedingungen. Dies sollte sich in einer adaptiven Ausgestaltung widerspiegeln (Gessler, 2012, S. 51, sowie GPM, 2017, S. 106). Entscheidend für einen erfolgreichen Projektverlauf kann eine Typisierung des Projekts in der frühen Planungs- oder Initiierungsphase sein, da so für das Projektmanagement die ersten grundlegenden Informationen zur Ausarbeitung des Projektdesigns gegeben sind (Frick et al., 2019, S. 1006).
Agil, klassisch oder hybrid?
Aus der bitteren Erkenntnis nach wie vor schlechter allgemeiner Erfolgsquoten von Projekten haben sich diese "Pole" des Projektmanagements gebildet, gekennzeichnet durch agile versus sog. klassische Vorgehensweisen. Verschiedene Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass häufig unternehmens- und kontextbezogen ein hybrider Methodenmix eingesetzt wird, also standardisierte Vorgehensweisen nicht in ihrer ursprünglich erdachten Reinform angewendet werden (Blust, 2019). Einige Autor:innen bezeichnen Projektmanagementmethoden als hybrid, wenn sie agile und klassische Techniken kombinieren (z.B. Kurtz/Sauer, 2018). Andere wiederum fokussieren die sequenzielle Kombination klassischer Phasenmodelle (z.B. Wasserfall) mit agilen Methoden, wie sie z.B. in Scrum verwendet werden (z.B. Sandhaus et al., 2014).
Seit einigen Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen damit, welche charakteristischen Merkmale eines Projekts und seines Umfelds explizit die Frage beantworten können, ob ein plangetrieben-hierarchischer (aka traditionell/klassisch) oder ein regelbasiert-iterativer (aka agil) Ansatz möglich und sinnvoll ist. Als Entscheidungshilfe zur Klärung der Frage, welche Vorgehensweise – agil oder plangetrieben – mit Blick auf ein konkretes Projekt die beste sei, wird vielfach die sog. Stacey-Matrix ins Spiel gebracht. In der aktuellen Fassung führt die Stacey-Matrix in der Regel die Dimensionen Unsicherheit bzgl. der Anforderungen versus Unsicherheit bzgl. des Vorgehens auf. Die Stacey-Matrix ist jedoch vielmehr ein Diagramm, das eine Einordnung vorliegender Probleme nach den o.g. zwei Dimensionen ermöglicht (Stacey, 2007). Komplexität lässt sich jedoch nicht alleine mit den Kriterien Unsicherheit bzgl. der Anforderungen sowie des Vorgehens aufspannen (Hüsselmann, 2021, S. 64-76).
Komplexität versus Kompliziertheit
Besteht der Projektgegenstand aus einer Vielzahl von Komponenten, die zudem vernetzt sind und über die Zeit gesehen ein dynamisches Verhalten und Emergenz zeigen, handelt es sich um ein komplexes Projekt. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass in einem Projekt viele Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Elementen bestehen. Im Gegensatz zu einem komplizierten Projekt, das sich trotz der vielschichtigen Elemente strukturieren und planen lässt, verhindern die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten in komplexen Projekten eine für ein klassisches Vorgehen nötige Planung. Gleichzeitig gelten die Einschränkungen, die ein kompliziertes Projekt wenig geeignet für agile Vorgehensweisen machen, auch für komplexe Projekte. Im Kontext von Lean Project Management werden Ansätze ausgeführt, komplexe Projekte zu vereinfachen und zu zerlegen, um entweder die Wechselwirkungen zu eliminieren oder die Anzahl der Elemente zu reduzieren und so das Projekt aus dem Bereich der komplexen Projekte herauszubewegen (Hüsselmann, 2021, S. 59-67).
Möglichkeit, Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von Methoden
Hinsichtlich der Wahl eines methodischen Ansatzes muss zwischen der Möglichkeit und der Sinnhaftigkeit eines Einsatzes unterschieden werden (Boehm/Turner, 2003; Feldmüller, 2018). D.h., es muss schlussendlich bewertet werden, ob ein methodischer Ansatz in einem Umfeld möglich ist, ob dieser Nutzen bringt und daher angewendet werden sollte oder ob dies aufgrund der Konstellation sogar geboten, also nötig ist (siehe Bild 1).
…Sofort weiterlesen und testen
Erster Monat kostenlos,
dann 24,99 € pro Monat
-
Know-how von über 1.000 Profis
-
Methoden für alle Aufgaben
-
Websessions mit Top-Expert:innen










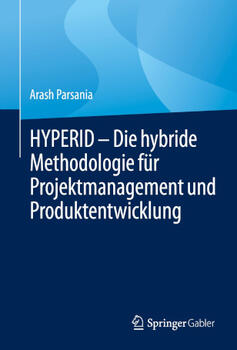
Fundierter und umfassender…
31.07.2023
Fundierter und umfassender Beitrag und zeigt schön die grundsätzlichen Dimensionen einer solchen Projektentscheidung auf.
Da ich in einer Unternehmensberatung arbeite, habe ich nach dem Artikel das Empfinden, dass 90% meiner Projekte eher einen klassischen Ansatz haben (müssen / werden / sollten), da die Unternehmens- und Projektteam spezifischen Merkmal (Rechtliche Anforderungen, Größe, Lokation und Teamgröße) es gar nicht anders zu lassen. Allerdings habe ich auch bereits die Erfahrung gemacht, dass eine vorgelagerte Phase mittels Design Thinking helfen kann, Struktur und Fokus für das dann startende plangetriebene Projekt zu bringen.
Zusatz: Für mich bleibt…
31.07.2023
Zusatz: Für mich bleibt dennoch die Frage, wie ich bei einem klassischen Projekt das Thema Unsicherheit und Vertrauen mit einbeziehen kann. Denn egal ob klassich oder agil, große Projekte haben in meinem Fall immer auch den Aspekt der Dynamiken und Unsicherheiten auf verschiedenen Ebenen. Und gerade hier scheint mir der "klassiche Führungsstil" nicht zeiteitgemäß - auch wenn ich mich in einem klassischen Projekt Set-Up befinde.
Der LeanPM-Ansatz gibt da…
17.08.2023
Der LeanPM-Ansatz gibt da durchaus Hilfen, z.B. Praktiken wie Rollierende Planung, Last Responsible Moment oder MuSCoW-Klassifizierung der Anforderungen etc. einzusetzen ... um nur einige zu nennen.
Danke für Ihre hilfreichen Kommentare und beste Grüße
Claus Hüsselmann
Liebe Frau Büthe,
03.08.2023
vielen Dank für Ihre Rückmeldung zu diesem Artikel und den Einblick in Ihre eigene Projektarbeit. Es freut mich, dass Sie die Inhalte des Artikels auf Ihre Projekte beziehen und noch einmal für sich einordnen konnten, welche Vorgehensweise für diese gut geeignet ist. Setzen Sie zum Einschätzen neuer Projekte gerne auch das zum Artikel passende Excel-Tool ein: https://www.projektmagazin.de/tool/klassisch-agil-entscheidungsanalyse-….
Viele Grüße,
Hannah-Magdalena Bütow (Redaktion)
"Vorgelagerte Phase" ist m.E…
17.08.2023
"Vorgelagerte Phase" ist m.E. das entscheidende Stichwort. Denn es stellt sich ja in der Regel die Frage, wie man mit dem vmtl. uneindeutigen Resultat der Analyse umgehen kann. Und da kommt man wohl zwangsläufig auf irgendeine Variante hybriden Vorgehens ... z.B. eine ergebnisoffene Phase der Planung vorzuschalten. Es sei denn, man kann Rahmenbedingungen ändern ...