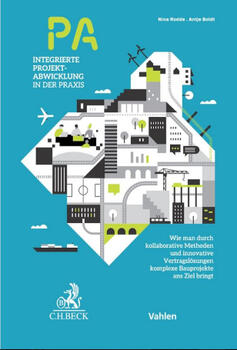So geht der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers richtig um
Auftragnehmer legen Angeboten in der Regel ihre eigenen Lieferbedingungen in Form der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zugrunde. Der Auftraggeber gewinnt dadurch leicht den Eindruck, dass er Regelungen akzeptieren soll, die ihn benachteiligen. Rechtsanwalt Christoph Zahrnt erklärt, wie der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers umgehen sollte, um sich gegen nachteilige Klauseln abzusichern. Die Ratschläge richten sich insbesondere an Auftraggeber von IT-Projekten, gelten grundsätzlich aber auch für andere Projektarten.
So geht der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers richtig um
Auftragnehmer legen Angeboten in der Regel ihre eigenen Lieferbedingungen in Form der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zugrunde. Der Auftraggeber gewinnt dadurch leicht den Eindruck, dass er Regelungen akzeptieren soll, die ihn benachteiligen. Rechtsanwalt Christoph Zahrnt erklärt, wie der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers umgehen sollte, um sich gegen nachteilige Klauseln abzusichern. Die Ratschläge richten sich insbesondere an Auftraggeber von IT-Projekten, gelten grundsätzlich aber auch für andere Projektarten.
Auftragnehmer legen ihren Angeboten in der Regel ihre eigenen Lieferbedingungen zugrunde, bei IT-Projekten z.B. bezüglich der Überlassung und Einführung von Standardsoftware. Diese Lieferbedingungen sind im Rechtssinne Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und werden meist als gesondertes Dokument an das eigentliche Angebot angehängt. Der Auftragnehmer verfolgt mit seinen AGB drei Ziele:
- Regelungen, die in jedem Vertrag nötig sind, müssen nur einmal formuliert werden.
- Allgemeine gesetzliche Regelungen werden für den Vertragstyp konkretisiert.
Es kann z.B. festgelegt werden, dass der Kunde seine Anforderungen in gewissem Umfang ändern darf und der Auftragnehmer dafür einen Ausgleich verlangen kann, beispielsweise hinsichtlich der Vergütung und der Termine. - Der Auftragnehmer nutzt die gesetzlichen Spielräume aus und verschiebt die Rechtslage zu seinen Gunsten. Beispielsweise verkürzt er die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln von 24 auf zwölf Monate ("Gewährleistungsfrist").
Der letzte Punkt ist für den Auftraggeber problematisch, da seine rechtliche Position dadurch verschlechtert wird. AGB-Klauseln, die den Auftraggeber stark benachteiligen, sind zwar automatisch unwirksam. Trotzdem bleibt die Unsicherheit, welche anderen für ihn ungünstigen Regelungen gültig sind. Dieser Tipp zeigt, wie der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers umgehen sollte, um sich gegen nachteilige Klauseln abzusichern.
Minimallösung: Kontrolle der AGB
Die Minimallösung für jeden Auftraggeber besteht darin, die AGB zu kontrollieren oder einen Rechtsberater damit zu beauftragen. Teile der AGB, die für beide Seiten sinnvoll sind, können beibehalten werden. Enthalten die AGB Klauseln, die für den Auftraggeber nachteilig sind, sollte er den Auftragnehmer auffordern, diese abzuändern. Inwieweit der Auftraggeber damit Erfolg hat, hängt von der Marktlage ab. In einem Käufermarkt, wie beispielsweise dem für Projekte über gehobene Standardsoftware, werden viele Auftragnehmer weit gehend nachgeben.
Eigene Vertragsbedingungen einführen
Einige große Unternehmen führen im großen Umfang Projekte durch und haben deshalb spezielle Einkaufsbedingungen für ihren Bedarf geschaffen, z.B. für den Erwerb und die Einführung gehobener Standardsoftware oder für die Erstellung von Software. Große Unternehmen können aufgrund ihrer Marktmacht meist durchsetzen, dass ihre AGB anerkannt werden.
Viele große Unternehmen haben ihre AGB so ausgestaltet, dass sie auf die eigene Organisation zugeschnitten oder einseitig auf ihre Interessen ausgerichtet sind. Manchmal sind diese AGB professionell gestaltet und oft verlangen sie von beiden Vertragspartnern eine hochprofessionelle Durchführung des Projekts. Insbesondere aufgrund der letzten beiden Punkte ist es für kleinere Auftraggeber nur eingeschränkt oder gar nicht sinnvoll, solche Bedingungen zu übernehmen. Außerdem haben sie in der Regel nicht die Marktmacht, um besonders auftraggeberfreundliche Bedingungen durchzusetzen.
Kleinere Auftraggeber können Muster nutzen, diese werden insbesondere in Büchern angeboten. Die in den Mustern festgelegten Bedingungen überlagern die AGB des Auftragnehmers. Die Muster sind meist nicht so konzipiert, dass sie - entsprechend den AGB des Auftragnehmers - eine Bestellung ergänzen sollen. Vielmehr sind sie wie ein Vertrag gestaltet, der auf Anlagen verweist, in denen die Leistungen und die Leistungsdurchführung (also die eigentlichen Bestellanforderungen) beschrieben werden. Dieses Konzept ist verständlich. Es ist nicht sinnvoll, eine AGB-Vorlage zu verfassen, ohne auch ein Muster für die Bestellung zur Verfügung zu stellen, auf die sich die AGB-Vorlage bezieht. Mit der Aufgabe, ein Muster für die Bestellung zu verfassen, sind die Autoren aber oft überfordert, weil sie nicht über das notwendige Fachwissen verfügen.
Die Muster haben aber oft weitere Schwächen: Erstens enthalten sie vieles, was für den konkreten Fall nicht zutrifft oder überflüssig ist. Zweitens stellen sie oft überzogene Anforderungen an den Auftragnehmer. Beliebt ist beispielsweise der Satz, der Auftragnehmer erkläre, er habe sich den Betrieb des Kunden vorab so genau angesehen, dass er dessen Anforderungen alle detailliert kenne. Drittens vermitteln die Muster häufig ein falsches Sicherheitsgefühl: Viele Auftraggeber glauben, dass sie den Projekterfolg absichern können, indem sie besonderen Wert auf juristische Formulierungen legen. Um den Projekterfolg abzusichern, sind aber eine genaue Leistungsbeschreibung und ein gutes Projektmanagement von sehr viel größerer Bedeutung als juristische Klauseln. Diese spielen erst dann eine Rolle, wenn das Projekt in eine Schieflage gerät oder sogar scheitert und man klären muss, wer den Schaden trägt.
AGB in das Angebot integrieren
Um die AGB des Auftraggebers transparenter zu machen und nachteilige Passagen herauszufiltern, kann der Kunde den Auftragnehmer auffordern, seine AGB in das Angebot zu integrieren. Dazu muss der Kunde in zwei Schritten vorgehen: Zunächst ist es notwendig, die eigene Bestellung sorgfältig zu erstellen und dabei alle wichtigen Punkte zu regeln: Wer soll was wann wie wofür (Bezahlung) tun? Der Text der Bestellung hat Vorrang vor den AGB des Auftragnehmers, ohne dass widersprechende Regelungen in den AGB formal geändert werden müssen. Legt der Kunde in seiner Bestellung z.B. die Regelung "Gewährleistungsfrist 24 Monate" fest, ist damit die AGB-Klausel "Gewährleistungsfrist 12 Monate" automatisch ungültig.
Auftragnehmer legen ihren Angeboten in der Regel ihre eigenen Lieferbedingungen zugrunde, bei IT-Projekten z.B. bezüglich der Überlassung und Einführung von Standardsoftware. Diese Lieferbedingungen sind im Rechtssinne Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und werden meist als gesondertes Dokument an das eigentliche Angebot angehängt. Der Auftragnehmer verfolgt mit seinen AGB drei Ziele:
- Regelungen, die in jedem Vertrag nötig sind, müssen nur einmal formuliert werden.
- Allgemeine gesetzliche Regelungen werden für den Vertragstyp konkretisiert.
Es kann z.B. festgelegt werden, dass der Kunde seine Anforderungen in gewissem Umfang ändern darf und der Auftragnehmer dafür einen Ausgleich verlangen kann, beispielsweise hinsichtlich der Vergütung und der Termine. - Der Auftragnehmer nutzt die gesetzlichen Spielräume aus und verschiebt die Rechtslage zu seinen Gunsten. Beispielsweise verkürzt er die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln von 24 auf zwölf Monate ("Gewährleistungsfrist").
Der letzte Punkt ist für den Auftraggeber problematisch, da seine rechtliche Position dadurch verschlechtert wird. AGB-Klauseln, die den Auftraggeber stark benachteiligen, sind zwar automatisch unwirksam. Trotzdem bleibt die Unsicherheit, welche anderen für ihn ungünstigen Regelungen gültig sind. Dieser Tipp zeigt, wie der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers umgehen sollte, um sich gegen nachteilige Klauseln abzusichern.
Minimallösung: Kontrolle der AGB
Die Minimallösung für jeden Auftraggeber besteht darin, die AGB zu kontrollieren oder einen Rechtsberater damit zu beauftragen. Teile der AGB, die für beide Seiten sinnvoll sind, können beibehalten werden. Enthalten die AGB Klauseln, die für den Auftraggeber nachteilig sind, sollte er den Auftragnehmer auffordern, diese abzuändern. Inwieweit der Auftraggeber damit Erfolg hat, hängt von der Marktlage ab. In einem Käufermarkt, wie beispielsweise dem für Projekte über gehobene Standardsoftware, werden viele Auftragnehmer weit gehend nachgeben.
Eigene Vertragsbedingungen einführen
Einige große Unternehmen führen im großen Umfang Projekte durch und haben deshalb spezielle Einkaufsbedingungen für ihren Bedarf geschaffen, z.B. für den Erwerb und die Einführung gehobener Standardsoftware oder für die Erstellung von Software. Große Unternehmen können aufgrund ihrer Marktmacht meist durchsetzen, dass ihre AGB anerkannt werden.
Viele große Unternehmen haben ihre AGB so ausgestaltet, dass sie auf die eigene Organisation zugeschnitten oder einseitig auf ihre Interessen ausgerichtet sind. Manchmal sind diese AGB professionell gestaltet und oft verlangen sie von beiden Vertragspartnern eine hochprofessionelle Durchführung des Projekts. Insbesondere aufgrund der letzten beiden Punkte ist es für kleinere Auftraggeber nur eingeschränkt oder gar nicht sinnvoll, solche Bedingungen zu übernehmen. Außerdem haben sie in der Regel nicht die Marktmacht, um besonders auftraggeberfreundliche Bedingungen durchzusetzen.
Kleinere Auftraggeber können Muster nutzen, diese werden insbesondere in Büchern angeboten. Die in den Mustern festgelegten Bedingungen überlagern die AGB des Auftragnehmers. Die Muster sind meist nicht so konzipiert, dass sie - entsprechend den AGB des Auftragnehmers - eine Bestellung ergänzen sollen. Vielmehr sind sie wie ein Vertrag gestaltet, der auf Anlagen verweist, in denen die Leistungen und die Leistungsdurchführung (also die eigentlichen Bestellanforderungen) beschrieben werden. Dieses Konzept ist verständlich. Es ist nicht sinnvoll, eine AGB-Vorlage zu verfassen, ohne auch ein Muster für die Bestellung zur Verfügung zu stellen, auf die sich die AGB-Vorlage bezieht. Mit der Aufgabe, ein Muster für die Bestellung zu verfassen, sind die Autoren aber oft überfordert, weil sie nicht über das notwendige Fachwissen verfügen.
Die Muster haben aber oft weitere Schwächen: Erstens enthalten sie vieles, was für den konkreten Fall nicht zutrifft oder überflüssig ist. Zweitens stellen sie oft überzogene Anforderungen an den Auftragnehmer. Beliebt ist beispielsweise der Satz, der Auftragnehmer erkläre, er habe sich den Betrieb des Kunden vorab so genau angesehen, dass er dessen Anforderungen alle detailliert kenne. Drittens vermitteln die Muster häufig ein falsches Sicherheitsgefühl: Viele Auftraggeber glauben, dass sie den Projekterfolg absichern können, indem sie besonderen Wert auf juristische Formulierungen legen. Um den Projekterfolg abzusichern, sind aber eine genaue Leistungsbeschreibung und ein gutes Projektmanagement von sehr viel größerer Bedeutung als juristische Klauseln. Diese spielen erst dann eine Rolle, wenn das Projekt in eine Schieflage gerät oder sogar scheitert und man klären muss, wer den Schaden trägt.
AGB in das Angebot integrieren
Um die AGB des Auftraggebers transparenter zu machen und nachteilige Passagen herauszufiltern, kann der Kunde den Auftragnehmer auffordern, seine AGB in das Angebot zu integrieren. Dazu muss der Kunde in zwei Schritten vorgehen: Zunächst ist es notwendig, die eigene Bestellung sorgfältig zu erstellen und dabei alle wichtigen Punkte zu regeln: Wer soll was wann wie wofür (Bezahlung) tun? Der Text der Bestellung hat Vorrang vor den AGB des Auftragnehmers, ohne dass widersprechende Regelungen in den AGB formal geändert werden müssen. Legt der Kunde in seiner Bestellung z.B. die Regelung "Gewährleistungsfrist 24 Monate" fest, ist damit die AGB-Klausel "Gewährleistungsfrist 12 Monate" automatisch ungültig.
…Auftragnehmer legen ihren Angeboten in der Regel ihre eigenen Lieferbedingungen zugrunde, bei IT-Projekten z.B. bezüglich der Überlassung und Einführung von Standardsoftware. Diese Lieferbedingungen sind im Rechtssinne Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und werden meist als gesondertes Dokument an das eigentliche Angebot angehängt. Der Auftragnehmer verfolgt mit seinen AGB drei Ziele:
- Regelungen, die in jedem Vertrag nötig sind, müssen nur einmal formuliert werden.
- Allgemeine gesetzliche Regelungen werden für den Vertragstyp konkretisiert.
Es kann z.B. festgelegt werden, dass der Kunde seine Anforderungen in gewissem Umfang ändern darf und der Auftragnehmer dafür einen Ausgleich verlangen kann, beispielsweise hinsichtlich der Vergütung und der Termine. - Der Auftragnehmer nutzt die gesetzlichen Spielräume aus und verschiebt die Rechtslage zu seinen Gunsten. Beispielsweise verkürzt er die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln von 24 auf zwölf Monate ("Gewährleistungsfrist").
Der letzte Punkt ist für den Auftraggeber problematisch, da seine rechtliche Position dadurch verschlechtert wird. AGB-Klauseln, die den Auftraggeber stark benachteiligen, sind zwar automatisch unwirksam. Trotzdem bleibt die Unsicherheit, welche anderen für ihn ungünstigen Regelungen gültig sind. Dieser Tipp zeigt, wie der Auftraggeber mit den AGB des Auftragnehmers umgehen sollte, um sich gegen nachteilige Klauseln abzusichern.
Minimallösung: Kontrolle der AGB
Die Minimallösung für jeden Auftraggeber besteht darin, die AGB zu kontrollieren oder einen Rechtsberater damit zu beauftragen. Teile der AGB, die für beide Seiten sinnvoll sind, können beibehalten werden. Enthalten die AGB Klauseln, die für den Auftraggeber nachteilig sind, sollte er den Auftragnehmer auffordern, diese abzuändern. Inwieweit der Auftraggeber damit Erfolg hat, hängt von der Marktlage ab. In einem Käufermarkt, wie beispielsweise dem für Projekte über gehobene Standardsoftware, werden viele Auftragnehmer weit gehend nachgeben.
Eigene Vertragsbedingungen einführen
Einige große Unternehmen führen im großen Umfang Projekte durch und haben deshalb spezielle Einkaufsbedingungen für ihren Bedarf geschaffen, z.B. für den Erwerb und die Einführung gehobener Standardsoftware oder für die Erstellung von Software. Große Unternehmen können aufgrund ihrer Marktmacht meist durchsetzen, dass ihre AGB anerkannt werden.
Viele große Unternehmen haben ihre AGB so ausgestaltet, dass sie auf die eigene Organisation zugeschnitten oder einseitig auf ihre Interessen ausgerichtet sind. Manchmal sind diese AGB professionell gestaltet und oft verlangen sie von beiden Vertragspartnern eine hochprofessionelle Durchführung des Projekts. Insbesondere aufgrund der letzten beiden Punkte ist es für kleinere Auftraggeber nur eingeschränkt oder gar nicht sinnvoll, solche Bedingungen zu übernehmen. Außerdem haben sie in der Regel nicht die Marktmacht, um besonders auftraggeberfreundliche Bedingungen durchzusetzen.
Kleinere Auftraggeber können Muster nutzen, diese werden insbesondere in Büchern angeboten. Die in den Mustern festgelegten Bedingungen überlagern die AGB des Auftragnehmers. Die Muster sind meist nicht so konzipiert, dass sie - entsprechend den AGB des Auftragnehmers - eine Bestellung ergänzen sollen. Vielmehr sind sie wie ein Vertrag gestaltet, der auf Anlagen verweist, in denen die Leistungen und die Leistungsdurchführung (also die eigentlichen Bestellanforderungen) beschrieben werden. Dieses Konzept ist verständlich. Es ist nicht sinnvoll, eine AGB-Vorlage zu verfassen, ohne auch ein Muster für die Bestellung zur Verfügung zu stellen, auf die sich die AGB-Vorlage bezieht. Mit der Aufgabe, ein Muster für die Bestellung zu verfassen, sind die Autoren aber oft überfordert, weil sie nicht über das notwendige Fachwissen verfügen.
Die Muster haben aber oft weitere Schwächen: Erstens enthalten sie vieles, was für den konkreten Fall nicht zutrifft oder überflüssig ist. Zweitens stellen sie oft überzogene Anforderungen an den Auftragnehmer. Beliebt ist beispielsweise der Satz, der Auftragnehmer erkläre, er habe sich den Betrieb des Kunden vorab so genau angesehen, dass er dessen Anforderungen alle detailliert kenne. Drittens vermitteln die Muster häufig ein falsches Sicherheitsgefühl: Viele Auftraggeber glauben, dass sie den Projekterfolg absichern können, indem sie besonderen Wert auf juristische Formulierungen legen. Um den Projekterfolg abzusichern, sind aber eine genaue Leistungsbeschreibung und ein gutes Projektmanagement von sehr viel größerer Bedeutung als juristische Klauseln. Diese spielen erst dann eine Rolle, wenn das Projekt in eine Schieflage gerät oder sogar scheitert und man klären muss, wer den Schaden trägt.
AGB in das Angebot integrieren
Um die AGB des Auftraggebers transparenter zu machen und nachteilige Passagen herauszufiltern, kann der Kunde den Auftragnehmer auffordern, seine AGB in das Angebot zu integrieren. Dazu muss der Kunde in zwei Schritten vorgehen: Zunächst ist es notwendig, die eigene Bestellung sorgfältig zu erstellen und dabei alle wichtigen Punkte zu regeln: Wer soll was wann wie wofür (Bezahlung) tun? Der Text der Bestellung hat Vorrang vor den AGB des Auftragnehmers, ohne dass widersprechende Regelungen in den AGB formal geändert werden müssen. Legt der Kunde in seiner Bestellung z.B. die Regelung "Gewährleistungsfrist 24 Monate" fest, ist damit die AGB-Klausel "Gewährleistungsfrist 12 Monate" automatisch ungültig.
Im zweiten Schritt muss der Auftraggeber den Auftragnehmer auffordern, nur solche AGB-Regelungen in das Angebot aufzunehmen, die für das Projekt relevant sind. Diese Regelungen sollen dabei nicht einfach an das Ende des Angebots gehängt, sondern in das Angebot integriert werden. Z.B. sollen Klauseln zu Aufgaben und Vollmachten der Projektleiter unter dem Punkt "Projektleiter" oder Regelungen zu den Kommunikationswegen unter "Abwicklung" eingefügt werden.
Das hat zwei Vorteile: Zum einen ist das Angebot danach für die Personen besser zu verstehen, die den Vertrag durchführen sollen. Zum anderen wird der Auftraggeber die AGB-Klauseln, die er nicht integrieren konnte, am Ende des Angebots aufführen. Das sind in der Regel die Klauseln, die dem Auftragnehmer einen Vorteil verschaffen sollen und für das Projekt kaum relevant sind. Der Kunde kann mit dem Auftragnehmer dann abklären, ob diese Klauseln tatsächlich dazu beitragen, das Projekt erfolgreich durchzuführen. Gegebenenfalls können Benachteiligungen oder überflüssige Regelungen gestrichen oder abgeschwächt werden.
![]() Dieses Vorgehen birgt für den Kunden allerdings ein Risiko: Unfaire Regelungen, die als AGB-Klauseln rechtlich ungültig wären, werden durch die Aufnahme in das Angebot zu Individualvereinbarungen und damit wirksam. Der Kunde muss also sehr aufmerksam sein und darauf bestehen, dass Regelungen, die ihm dubios erscheinen, gestrichen werden.
Dieses Vorgehen birgt für den Kunden allerdings ein Risiko: Unfaire Regelungen, die als AGB-Klauseln rechtlich ungültig wären, werden durch die Aufnahme in das Angebot zu Individualvereinbarungen und damit wirksam. Der Kunde muss also sehr aufmerksam sein und darauf bestehen, dass Regelungen, die ihm dubios erscheinen, gestrichen werden.
Mehr zu dem Thema finde