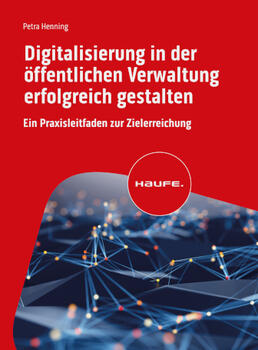Projektverträge: Rechtliche Aspekte bei der Abnahme
Inhalt
- Definition und Rechtsfolgen der Abnahme
- Konsequenzen der Schuldrechtsmodernisierung
- Ungeklärte Rechtslage bei Software
- W-Fragen bei der technischen Organisation der Abnahme
- Vereinbarte Abnahmeverfahren
- Musterklausel für den Vertrag über die Abnahme
- Fazit: Rechtzeitige Absprachen vermeiden später Ärger
Projektverträge: Rechtliche Aspekte bei der Abnahme
Inhalt
- Definition und Rechtsfolgen der Abnahme
- Konsequenzen der Schuldrechtsmodernisierung
- Ungeklärte Rechtslage bei Software
- W-Fragen bei der technischen Organisation der Abnahme
- Vereinbarte Abnahmeverfahren
- Musterklausel für den Vertrag über die Abnahme
- Fazit: Rechtzeitige Absprachen vermeiden später Ärger
Die Abnahme ist eine entscheidende Station im Verlauf eines Projekts: Das Risiko fällt vom Auftragnehmer an den Auftraggeber zurück. Im Zentrum dieses Beitrags steht die Bedeutung der Abnahme im juristischen Sinne - insbesondere mit Blick auf die Änderungen, die das neue Schuldrecht vom 1. Januar 2002 mit sich gebracht hat.
Der Artikel enthält Vorschläge für Regelungen sowie eine Musterklausel, mit deren Hilfe die Vertragspartner in einem Projekt die Abnahme optimal organisieren können. Als Beispiel dient die Softwareentwicklung. Die Erläuterungen und Tipps lassen sich aber problemlos auf andere Branchen übertragen.
Definition und Rechtsfolgen der Abnahme
Abnahme bedeutet: "Entgegennahme des Werks als im Wesentlichen vertragsgemäß". Indem er für ein bestimmtes Arbeitsergebnis die Abnahme erklärt, gibt der Auftraggeber (im Werkvertragsrecht Besteller genannt) zu erkennen: Der Auftragnehmer (im Werkvertragsrecht Unternehmer genannt) hat die geschuldete Leistung so erbracht, dass der Vertrag als erfüllt gilt.
Erst nach der Abnahme ist der Besteller dazu verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu bezahlen. Dies ist der Fall, wenn - wie üblich - keine abweichenden Regelungen vereinbart sind. Anders als bei Dienstverträgen, bei denen der Auftragnehmer nur Leistungen erbringen muss, schuldet er bei Werkverträgen einen vereinbarten Erfolg. Erst wenn dieser Erfolg erreicht ist, ist er berechtigt, eine Vergütung zu verlangen.
Der "Erfolg" ist das einzig wichtige Unterscheidungskriterium zwischen Dienst- und Werkvertrag. Die in der Praxis häufige Vermutung, bei Leistungen, die nach Aufwand abgerechnet werden ("time and material") handle es sich zwingend um Dienstverträge, ist falsch. Auch Werkverträge werden häufig aufwandsabhängig und nach festen Fälligkeitszeitpunkten (z.B. Monatsende) vergütet.
Eine weitere Konsequenz der Abnahme ist, dass ab diesem Zeitpunkt die gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Fristen für die Haftung bei Sach- und Rechtsmängel laufen. Nach der Abnahme muss der Besteller nachweisen, dass ein aufgetretener Mangel bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorlag. Vor der Abnahme muss dagegen der Unternehmer dem Besteller nachweisen, dass er den Vertrag mangelfrei erfüllt hat.
Konsequenzen der Schuldrechtsmodernisierung
Rechtsprechung und Literatur qualifizieren Verträge über die Entwicklung von Individualsoftware überwiegend als Werkverträge. Die Folge ist, dass zum Abschluss von Individualsoftware-Projekten stets eine Abnahme notwendig ist.
Verträge über Anpassungen und Parametrisierungen von Standardsoftware, die einen Anteil am Gesamtprojektwert von rund 10% bis 15% überschreiten, werden als "Werklieferungsverträge" eingeordnet. Werklieferungsverträge sind Verträge, die den Unternehmer verpflichten, ein Werk aus Materialien herzustellen, die er selbst beschaffen muss. Nach altem Schuldrecht waren auf solche Werklieferungsverträge teilweise die Vorschriften des Kaufrechts und teilweise die Vorschriften des Werkvertragsrechts anwendbar. Nach Abschluss der Leistungserbringung sollte die Abnahmeregelung des Werkvertragsrechts gelten, besagte ein Verweis in § 651 BGB (alte Fassung). Im Zweifel war also ab einem Anteil individueller Leistungen von rund 10% bis 15% am Vertragsvolumen immer eine Abnahme nötig. Eine Abgrenzung zwischen Werk- und Werklieferungsverträgen erübrigte sich.
Zum 1. Januar 2002 wurde § 651 BGB im Rahmen der Schuldrechtsreform geändert. Bei Werklieferungsverträgen sollen nun, jedenfalls was das Ende der Leistungserbringung betrifft, die Regelungen des Kaufrechts anwendbar sein. Das hat die Konsequenz, dass keine Abnahme mehr stattfindet.
Nach Kaufrecht ist der maßgebliche Erfüllungszeitpunkt nicht die Abnahme, sondern die Ablieferung. Ablieferung bedeutet hierbei, dass der Käufer und Besteller die Leistungen nur entgegennimmt, aber nicht mehr sein Einverständnis mit deren Qualität erklären muss. Somit stellt sich die Frage, ob bei Projekten überhaupt noch eine Abnahme notwendig ist.