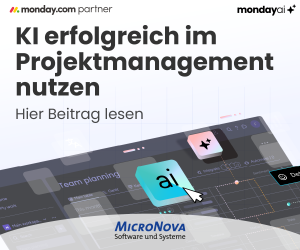Projektmanagement in multilokalen Projekten
Multilokale Projekte stellen selbst für erfahrene Projektleiter eine Herausforderung dar. Wie lassen sie sich effizient planen und steuern, wenn das Team verteilt an den verschiedensten Standorten arbeitet? Stefan Haffner beschreibt in diesem Beitrag typische Probleme in multilokalen Projekten und erläutert verschiedene Methoden zur Planung und Steuerung. Am Beispiel eines weltweiten Großprojekts aus dem Pharmabereich stellt der Autor einen konkreten Lösungsansatz vor und zeigt, welche Bedeutung einfache aber verbindliche Vereinbarungen auf globaler Ebene für den Projekterfolg haben.
Projektmanagement in multilokalen Projekten
Multilokale Projekte stellen selbst für erfahrene Projektleiter eine Herausforderung dar. Wie lassen sie sich effizient planen und steuern, wenn das Team verteilt an den verschiedensten Standorten arbeitet? Stefan Haffner beschreibt in diesem Beitrag typische Probleme in multilokalen Projekten und erläutert verschiedene Methoden zur Planung und Steuerung. Am Beispiel eines weltweiten Großprojekts aus dem Pharmabereich stellt der Autor einen konkreten Lösungsansatz vor und zeigt, welche Bedeutung einfache aber verbindliche Vereinbarungen auf globaler Ebene für den Projekterfolg haben.
Projektmanagement in multilokalen Projekten stellen jeden Projektleiter vor eine Herausforderung: Wie kann er angesichts eines weltweit verteilten Teams sein Projekt effizient planen und steuern? Im Zentrum dieses Beitrags stehen zunächst einige Beispiele für die Probleme in multilokalen Projekten, mögliche Projektstrukturen sowie Planungs- und Steuerungsmethodiken. Am Beispiel eines weltweiten Großprojekts aus dem Pharmabereich wird anschließend ein Lösungsansatz vorgestellt.
Projektstrukturen in multilokalen Projekten
Ein wesentlicher Unterschied gegenüber Projekten, die an nur einem Standort durchgeführt werden, lässt sich anhand der Projektstruktur und Aufgabenverteilung benennen. Bild 1 zeigt mögliche multilokale Projektstrukturen.

Bild 1: Multilokale Projektstrukturen.
Sind Projektteam und Aufgaben auf verschiedene Standorte verteilt, steht das Projektmanagement vor einer besonderen Herausforderung: Viele Fragestellungen, die in standortbezogenen Projekten durch direkte Kommunikation auf dem "kleinen Dienstweg" gelöst werden können, schaffen in verteilten Projektteams große Probleme.
Neben der Projektstruktur hat auch die Organisation des Unternehmens erheblichen Einfluss auf den Projekterfolg. Besonders eine fehlende Priorisierung von Projekten gegenüber der Linienarbeit führt wegen der direkten Weisungsbefugnis von Linienvorgesetzten gegenüber ihren Mitarbeitern häufig dazu, dass die Projektarbeit vernachlässigt wird. Ein starker Projektauftraggeber und entsprechende Aufmerksamkeit des Managements bilden daher einen besonderen Erfolgsfaktor für das Projekt.
Schwierigkeiten in multilokalen Projekten bereiten die folgenden Aspekte:
- kulturelle Unterschiede sowie andere Arbeits- und Vorgehensweisen, zum Beispiel das unterschiedliche Meeting-Verhalten verschiedener Nationalitäten
- Schwierigkeiten in der Teamkommunikation aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen und Sprachfähigkeiten, oft verstärkt durch Probleme mit den verschiedenen Sprachversionen von Software
- großer Abstimmungsaufwand zwischen den Standorten, etwa bei der Terminkoordintaion für übergreifende Abstimmungen und Workshops
- die unterschiedliche organisatorische Ausgestaltung der verschiedenen beteiligten Unternehmensbereiche. Damit verbunden ist das Problem, dass der Projektleiter die richtigen Ansprechpartner nur schwer identifizieren kann, da diese an verschiedenen Stellen der lokalen Organisation aufgehängt sind.
Für den Erfolg eines multilokalen Projekts ist vor allem die Auswahl einer geeigneten Planungs- und Steuerungsmethodik von Bedeutung. Hier bieten sich drei Möglichkeiten an:
- zentrale Projektplanung
- dezentrale Projektplanung
- gemischt zentrale/dezentrale Projektplanung
Diese Planungsmethodiken besitzen unterschiedliche Vorzüge. Eine zentrale Projektplanung hat beispielsweise den Vorteil, dass aufwendige Abstimmungen zur Vereinheitlichung der Planung unnötig sind. Dafür schränkt sie die Flexibilität der Projektteams vor Ort eventuell stark ein.
Für eine dezentrale Planung spricht die größere Freiheit der Teilprojektverantwortlichen in der Planung und Durchführung. Eine vollständig dezentrale Planung führt dafür aber zu einem höheren Abstimmungsaufwand zwischen den Projektmitarbeitern. Sinn macht diese Vorgehensweise zum Beispiel dann, wenn der Projektleiter keinerlei Weisungsbefugnis gegenüber den Projektteams an den verschiedenen Projektstandorten hat.
Die gemischt zentrale/dezentrale Projektplanung kombiniert die Vorteile der beiden vorherigen Methoden. Dabei gibt die zentrale Projektleitung dem Projektteam einen groben Planungsrahmen vor. So wäre zum Beispiel bei einem globalen Software-Rollout-Projekt denkbar, dass sie den Teams vor Ort nur Meilensteine und ein Vorgehensmodell zum Rollout vorschreibt.