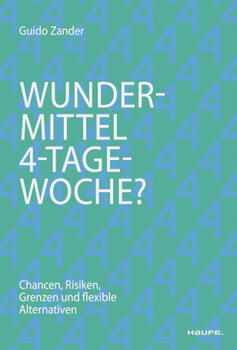Der Weg zu qualifizierten Projektentscheidungen
Der Weg zu qualifizierten Projektentscheidungen
Dieser Beitrag befasst sich mit Bedeutung und Struktur der Entscheidungsfindung in Projekten. Im ersten Teil wurde die "Einbettung" von Projektentscheidungen in das Gesamtprojekt beschrieben und auf die besondere Bedeutung einer fundierten Situationsdiagnose für qualifizierte Projektentscheidungen eingegangen. Im hier vorliegenden zweiten Teil werden die eigentlichen Schritte der Entscheidungsfindung genauer untersucht und die typischen Herausforderungen für Projektleiter und -team bei der korrekten Bearbeitung der insgesamt neun Schritte der Entscheidungsanalyse aufgezeigt.
Unter Entscheidungsfindung versteht man den eigentlichen Prozess, die beste Variante aus mehreren Alternativen zu selektieren. Nahezu jede Projektarbeit strebt durch eine möglichst fundierte Situationsdiagnose die Entwicklung mehrerer Alternativen an. In erfolgreichen Projektkulturen ist es sogar obligatorisch, möglichst unterschiedliche Alternativen zu betrachten. Das gilt als wesentliches Element einer gewissenhaften Zukunftssicherung, basierend auf der Erkenntnis, dass die Folgen einer suboptimalen Lösung nachhaltige Schäden bewirken können.
Beispiel
Bei der Neuordnung der An- und Abflugrouten an einem internationalen Großflughafen hatte das zuständige Flugsicherungsunternehmen darauf verzichtet, zusätzliche Alternativrouten zu entwickeln. Es habe infolge europäischer Vorgaben praktisch keinen planerischen Spielraum für lärmärmere Varianten gegeben, wurde in ausführlichen Stellungnahmen erläutert. Im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung stellte die Gegenpartei jedoch acht Alternativrouten vor, die in Fachkreisen konzipiert worden waren. Dieser Umstand befähigte das Flugsicherungsunternehmen nach dem Verlust des Prozesses binnen Monaten insgesamt eine zweistellige Zahl realisierbarer Alternativen zu entwickeln. Die hieraus selektierte kapazitätsneutrale Bestvariante führt nach anerkannten Kriterien des Lärmmanagements zu einer Entlastungsbilanz von über 10.000 (!) Einwohnern.
Entscheidungsanalyse im Überblick
Nahezu alle erfolgreichen Projektentscheidungen, die sich zugleich einer hohen Akzeptanz und Transparenz rühmen, basieren auf der Methode der Entscheidungsanalyse (auch Entscheidungsmatrix oder Nutzwertanalyse). Das Verfahren ist heute weit verbreitet und wird in Form von Stiftung-Warentest-Produktvergleichen oder Automobiltests von Millionen Menschen zumindest passiv zur Kenntnis genommen.
Ganz anders ist es um die Anwendung der Methode bei wichtigen Projektentscheidungen bestellt: Selbst erfahrene Projektleiter haben Vorbehalte bezüglich der Anwendung der Entscheidungsanalyse im eigenen Projekt. Die Hauptgründe dieser Vorbehalte liegen
- in den Gestaltungsmöglichkeiten der auf Zahlen basierenden Bewertung, die Manipulation oder zumindest Scheinrationalität zulasse sowie
- in der Herausforderung, einen Konsens mit zahlreichen Projektbeteiligten aus Entwicklung, Beschaffung, Einkauf, Marketing und Produktion herzustellen, deren Interessen naturgemäß gegenläufig seien
Bei der Durchführung einer komplexen Entscheidungsanalyse gibt es tatsächlich viele Fehlerquellen, denn das endgültige Entscheidungsergebnis wird in insgesamt neun Methodikschritten erarbeitet. Jeder methodische Fehler kann dazu führen, dass das Endergebnis vom Optimum abweicht - was es jedoch zu vermeiden gilt. In projektorientierten Unternehmen haben sich daher zielgerichtete auf der Entscheidungsanalyse basierende Verfahren entwickelt, die diesen Anforderungen Rechnung tragen. Nachfolgend werden die wesentlichen Erkenntnisse für die praktische Anwendung der Entscheidungsanalyse ausführlich behandelt.
Schritte der Entscheidungsanalyse
Die neun Schritte der Entscheidungsanalyse:
- Definition der Entscheidungssache
- Kriterien listen
- Muss- und Wunsch-Kriterien gruppieren
- Wunsch-Kriterien gewichten
- Alternativen aufstellen
- Alternativen bewerten
- Vorläufige Entscheidung
- Analyse potenzieller Probleme (Risikoanalyse)
- Endgültige Entscheidung
Schritt 1: Definition der Entscheidungssache
Mit der Definition der Entscheidungssache wird festgelegt, welche Alternativen zulässig sind bzw. nicht in Betracht gezogen werden können.
Beispiel
Ende der achtziger Jahre präsentiert der Projektleiter eines Engineering-Unternehmens seiner Geschäftsführung eines der ersten fertig entwickelten Navigationssysteme für zivile Straßenfahrzeuge (mit nicht unerheblich überzogenem Budget). Im Verlauf der Diskussion stellt sich heraus, dass die Geschäftsführung lediglich die "Technologie" entwickeln wollte, während die Projektgruppe das "Geschäftsfeld" einschließlich eigener Produktions- und Vertriebskapazitäten vorangetrieben hatte.
Beim Entscheidungsthema "Technologie" hätte das Projektteam nur aus verschiedenen technischen Konzepten das Beste selektieren und entwickeln dürfen. Das Entscheidungsthema "Geschäftsfeld" eröffnete hingegen eine Vielzahl weiter gehender Gestaltungsräume und Lösungsvarianten unter Einschluss einer Veränderung des Unternehmenszwecks vom reinen Engineering-Unternehmen zum Systemhersteller.